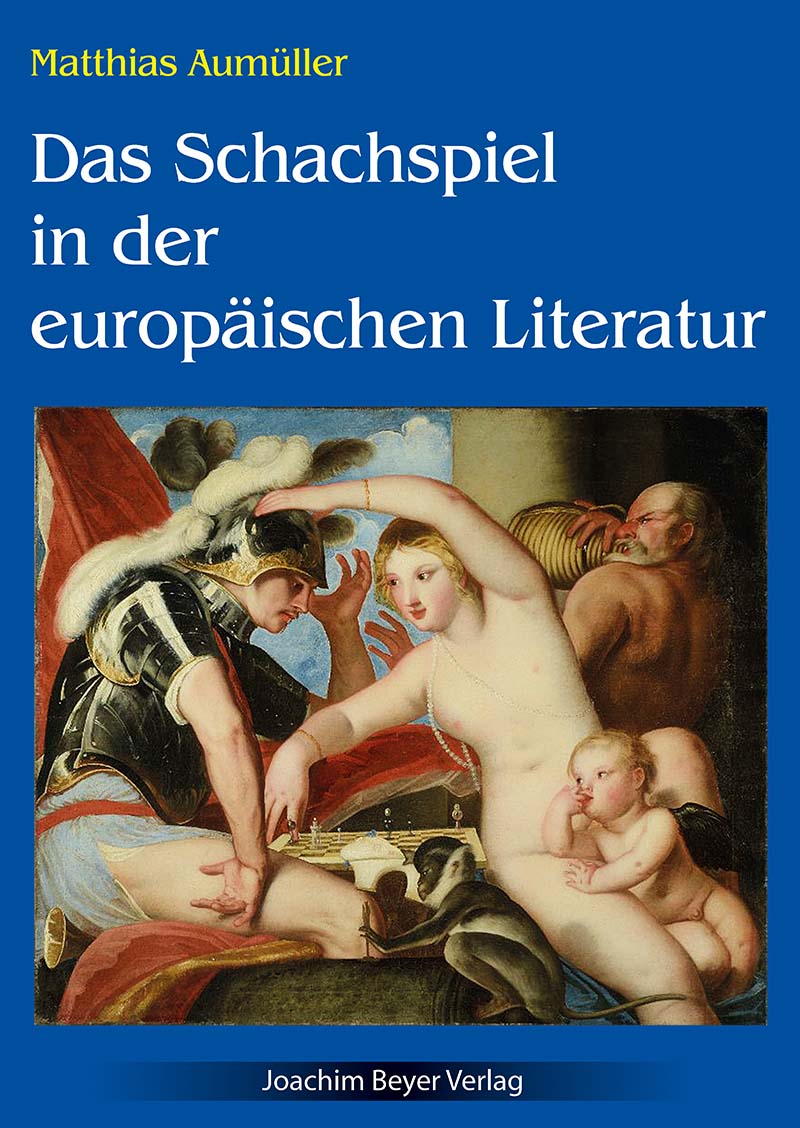Aumüller: Das Schachspiel in der europäischen Literatur
Produktinformationen "Aumüller: Das Schachspiel in der europäischen Literatur"
Schach gespielt wird nicht nur in Wirklichkeit, es wird auch in
erfundenen Geschichten gespielt. Literarische Schachpartien gibt es seit vielen
Jahrhunderten. Sie haben deutliche Spuren in der europäischen Literatur
hinterlassen. Im Mittelpunkt des Bandes stehen fünf literarische Texte,
sogenannte Schach-Poeme, die von Schachpartien handeln. Sie werden hier erstmals
ausführlich vorgestellt und in ihrem Zusammenhang von einem professionellen
Literaturwissenschaftler erklärt. Das Besondere an der Darstellung ist Matthias
Aumüllers Versuch, wissenschaftlich seriöse Forschungsergebnisse auf eine auch
Nicht-Philologen ansprechende, unterhaltsame Art und Weise zu präsentieren. Wie
von selbst erhalten die Leserinnen und Leser dabei einen Einblick in die
Mechanismen der europäischen Literaturgeschichte, die sich über die Jahrhunderte
nie isoliert in einem Land, sondern immer im Austausch der verschiedenen
Literaturen entwickelt hat.
Altkatalanisch, Neulateinisch, Polnisch, Italienisch, Englisch – das
sind die Sprachen, in denen die Schach-Poeme verfasst sind. Ihnen gemeinsam ist,
dass jeweils eine Schachpartie ihr Hauptthema ist. Sie unterscheiden sich
allerdings darin, dass jeweils andere Spielerinnen und Spieler beteiligt sind.
Und da die Poeme in unterschiedlichen Epochen und Kulturen entstanden, gibt es
weitere Unterschiede und Eigenheiten, deren Bedeutung in fünf Kapiteln ermittelt
wird.
Ihnen vorangestellt ist ein ausführliches Kapitel über die große
Verbreitung von Schach-Motiven in der mittelalterlichen Literatur, an deren Ende
die Erfindung der literarischen Schachpartie in einem alt-/mittelfranzösischen
Versepos steht.
Matthias Aumüller wurde mit einer Dissertation über die Literaturtheorie
des russländisch-ukrainischen Philologen Aleksandr Potebnja (1835-1891) an der
Universität Hamburg promoviert. Danach habilitierte er sich an der Universität
Wuppertal mit einer Arbeit zur Romanliteratur der DDR. Zuletzt erschien eine
Abhandlung zum unzuverlässigen Erzählen in der deutschsprachigen
Nachkriegsliteratur. Gegenwärtig ist er als SNF-Senior Researcher an der
Universität Fribourg (CH) beschäftigt. Ab 2024 wird er als Projektleiter der
Deutschen Forschungsgesellschaft an der Universität Halle-Wittenberg tätig
sein.
266 Seiten, kartoniert, Joachim Beyer Verlag
Anmelden